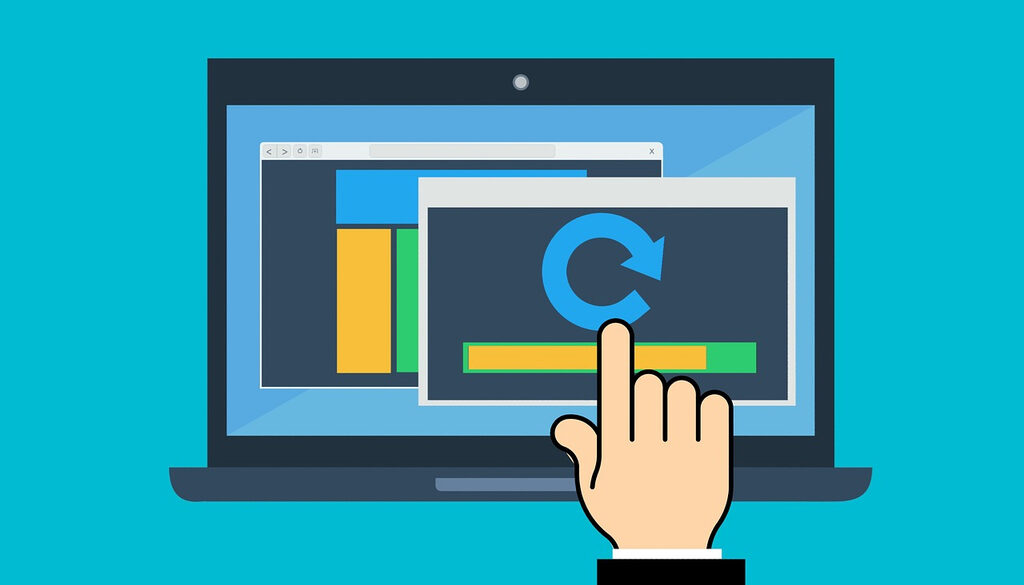Software-defined Hardware
Software übernimmt immer häufiger Funktionen, die früher als hardwarespezifisch galten. So werden bei „Software-defined Storage“ schon länger Laufwerke wie Festplatten, Partitionen, CD-ROM-Laufwerke und so weiter dynamisch emuliert, um eine Trennung zwischen Anwendungsebene und Hardware, also den physikalischen Geräten, zu schaffen. Auch „Software-defined Networks“, die Netzwerkverkehr dynamisch und bedarfsgerecht verteilen, gibt es schon lange.
Jetzt aber definiert die Software zunehmend die entscheidenden Funktionen, und dies bei Alltagsgegenständen wie bei komplexen Industrieanlagen.
Dies lässt sich am besten am Beispiel der Fotografie erläutern: Ging es früher für Fotografen darum, ein möglichst perfektes, mechanistisches Abbild der aufzunehmenden Szene zu erhalten und dazu je nach Einsatzzweck viel Geld in hochwertige Kameras und teure Spezialobjektive zu investieren, so haben moderne High-End-Smartphones Kamerasysteme, die bis zu drei oder vier separate Kameras (vom Weitwinkel bis zum Tele) enthalten.
Die „perfekte“ Aufnahme wird dann über Software und aus einer Kombination mehrerer Bilder, teilweise sogar der verschiedenen Linsen, berechnet.
KI-Algorithmen analysieren die Bildinhalte und versehen Porträts mit künstlicher Tiefenunschärfe („Bokeh“) oder rechnen die Verzerrungen und Vignettierungen des Objektivs aus den Rohdaten heraus. Nachtaufnahmen gelingen so sogar aus der freien Hand, denn es ist die Software, die ein Bild aus zahlreichen Einzelaufnahmen zusammensetzt, das bisher nur durch eine Langzeitbelichtung erzeugt werden konnte.
Damit übernimmt die Software die definierenden und kennzeichnenden Funktionen des Systems. Die Hardware dahinter muss nicht mehr „perfekt“ sein, sondern es werden Systeme kombiniert, die „gut genug“ sind. Gerade bei solchen algorithmischen generierten und in gewisser Weise manipulierten Aufnahmen entspricht das Ergebnis weniger einem Abbild der Realität, als vielmehr einem idealisierten Wunschbild – aber für Millionen Hobbyknipser sind das die besten Fotos, die sie je gemacht haben.
Wer schon bisher seine Fotos mit Instagram-Filtern bearbeitet hat, wird sich freuen, dass die Smartphone-Kamera so mit dem nächsten Softwareupdate vielleicht neue Tricks lernt, ohne Geld für neue Objektive und Vorsatzlinsen ausgeben zu müssen. Die verbaute Hardware deckt ein möglichst breites Einsatzgebiet ab, die Spezialisierung und Optimierung übernimmt die Software, die jederzeit ausgetauscht und adaptiert werden kann.
Die Software-defined Camera ist aber nur der gut sichtbare Elefant im Raum. Tatsächlich werden immer mehr Hardwarefunktionen durch Software ersetzt, ergänzt und emuliert. Dies zeigt sich bei Fahrzeugen, bei denen Software-Upgrades teilautonome Funktionen oder Performancesteigerungen freischalten, ohne in die Werkstatt zu müssen.
Und in der Industrie werden statt kundenspezifischer Lösungen auf der Hardwareebene Fertigungsanlagen, ja ganze Fertigungsstraßen heute zunehmend per Software adaptiert. Bestimmte Funktionen werden je nach Kundenwunsch aktiviert oder deaktiviert, zusätzliche Performancepakete können (kostenpflichtig) geordert werden, um den Maximalausstoß zu erhöhen oder neue Funktionen im Rahmen der Predictive Maintainance zu aktivieren.
Letztlich bestimmt die Software die Funktionalität der Maschine und der Hersteller kann sich Updates und softwareseitige Verbesserungen zusätzlich bezahlen lassen, auch im Rahmen von Wartungsverträgen.
Wozu die Hardware tatsächlich in der Lage ist, weiß der Kunde möglicherweise gar nicht, profitiert aber im Idealfall von der zusätzlichen Flexibilität und Leistungsreserve bei der Realisierung von Funktionen auf Softwarebasis.
(Bild von Mohamed Hassan auf Pixabay)