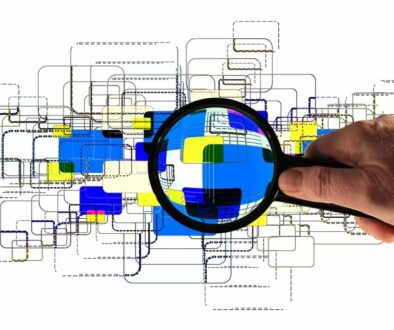Evolution statt Disruption: Innovationsentwicklung in Familienunternehmen
Familienunternehmen und Mittelständlern wird vielfach fehlende Innovations- und Digitalisierungsfähigkeit unterstellt. Die Realität sieht anders aus: Viele tradierte deutsche Unternehmen haben bereits Innovationszentren und eigene Einheiten gegründet, die gezielt neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln. Dabei offenbaren sich grundsätzliche Unterschiede zu Start-ups als auch zu Konzernen. Eine Untersuchung der WHU Otto Beisheim School of Management und der Beratungsgesellschaft ANDERSCH gibt erstmals quantitative und qualitative Einblicke.
- Nur acht Prozent beteiligen ihr Management an den neu geschaffenen Innovationseinheiten als Teilhaber.
- „Innovation Hubs“ bleiben eng an das Unternehmen angebunden; in rund einem Viertel der Fälle erfolgte die Ausgründung einer eigenständigen Gesellschaft.
- Solidität vor Kreativität: Chancen werden konsequent ergriffen, aber radikal neue Ideen finden seltener Einzug.
„Konzerne und Start-ups bestimmen in den letzten Jahren die öffentliche Debatte um Innovation in Deutschland, weil ‚Investment Hubs‘ und ‚Inkubatoren‘ intensiv in der Presse als relevante Vorstöße in der Unternehmensentwicklung beworben worden sind“, sagt Professor Nadine Kammerlander, Leiterin des Lehrstuhls Familienunternehmen an der WHU, die diese Studie inhaltlich begleitet hat. „Deutsche Familienunternehmen sind da ganz ihrem Naturell nach deutlich stiller. Sie hängen ihre Vorstöße nicht immer an die große Glocke. Darum sind wir sehr froh, dass wir hier einen intensiven Einblick erhalten haben.“
Insgesamt ist es den Forschern der WHU gelungen, persönliche Interviews mit 37 Unternehmen zu führen, deren Umsatz im Durchschnitt 748 Mio. Euro betragen hat. Ein Fünftel (22 Prozent) der Unternehmen hat einen Umsatz von bis zu 100 Mio. Euro erzielt, 16 Prozent lagen über 1 Mrd. Euro. Nadine Kammerlander sagt: „Viele der Unternehmen haben in der Öffentlichkeit bisher noch nie über ihre Aktivitäten im Bereich der Innovationsentwicklung berichtet. Die Gespräche haben uns einen Einblick gegeben, mit welchen Maßnahmen der deutsche Mittelstand Innovation systematisch entwickelt.“
Grundlegende Unterschiede zu Start-ups und dem Vorgehen von Konzernen werden deutlich
Ähnlich wie den Konzernen war allen in die Untersuchung einbezogenen Familienunternehmen bewusst, dass sich grundlegende Veränderung in Produkten oder Geschäftsmodellen nicht in der vorhandenen Struktur und mit den bisherigen Prozessen des Unternehmens abbilden lassen. Darum haben auch die untersuchten Betriebe eigene Einheiten eingerichtet, die aus der bisherigen Umgebung graduell herausgelöst worden sind, um sich gezielt mit Innovation und dazu notwendiger Investition zu beschäftigen.
„Die Familienunternehmen nutzen dazu das, was wir ‚Internes Corporate Venturing‘ nennen“, sagt Nadine Kammerlander. „Das heißt: Die meisten dieser Einheiten sind nicht sofort eigenständig, sondern entwickeln sich aus der bestehenden Struktur heraus – in Projektteams, aus Abteilungen oder durch interdisziplinäre, zunächst nicht formell organisierte Zusammenarbeit. Erst wenn die ersten konkreten Ergebnisse greifbar sind, folgt eine organisatorische Zusammenlegung zu einer neuen Einheit, die dann gezielt an der Weiterentwicklung dieser Ergebnisse arbeitet.“
Die Untersuchung hat ergeben, dass Familienunternehmen in Aufbau, Entwicklung und Führung ihrer Organisationseinheiten für Innovation, Digitalisierung und Investition anders vorgehen als Konzerne und Start-ups. Das soll in der Folge verdeutlicht werden:
1. Risiken werden klein gehalten – Chancen konsequent ergriffen
Familienunternehmen betätigen sich nur selten als Förderer oder Investoren von Ideen, die keine greifbaren Erfolge versprechen. Sie gehen in den meisten Fällen Schritt für Schritt vor: Ideenfindung, danach Validierung, erst dann Stück für Stück mehr Ressourceneinsatz.
Das machen Start-ups, aber auch viele Konzerne anders: Sie neigen zu einem hohen Risiko mit der Hoffnung, eine bahnbrechende Idee für Produkte und Geschäftsmodelle ins Portfolio zu holen. Dazu stellen sie sofort mehr Kapital zur Verfügung, ermöglichen damit Geschwindigkeit im Aufbau und schnellere Skalierungs- und Wachstumschancen. Mit dem Risiko, den vollen Einsatz zu verlieren.
„Das können und wollen sich viele Unternehmerfamilien nicht leisten“, sagt Nadine Kammerlander. „Sie investieren seit jeher vorsichtiger, denn es geht um ihr eigenes Geld und eine zu hohe Investition kann den Familienzusammenhalt sprengen. Gleichzeitig ergibt unsere Untersuchung jedoch, dass sie sehr systematisch und konsequent vorgehen, wenn sie eine mögliche geschäftliche Chance mit hohem Realisierungspotenzial sehen. Dafür senken Familien auch schon einmal die jährliche Ausschüttung, um das Kapital zu reinvestieren.“
2. Finanzierung auf Basis von Jahresbudget – gesichert, aber unflexibel
Im Vorfeld werden notwendige Kosten der Innovationseinheiten von Familienunternehmen geschätzt und ein Jahresbudget wird zugewiesen. Damit sind die Kosten gedeckelt. Das hat den Charme, auch hier in sicherer Umgebung agieren zu können, da der Aufwand für alle Seiten transparent ist.
Nadine Kammerlander sagt: „Allerdings gibt es in diesem Ansatz auch weniger Flexibilität, auf unerwartete Gelegenheiten unmittelbar zu reagieren, wenn das Geld schon verplant ist.“
Start-ups haben eine größere Manövrierfähigkeit, da sie ihre Liquidität häufig mit Finanzierungsrunden sicherstellen. Sie treten Stück für Stück Anteile an neue Investoren ab und können damit sehr schnell Kapital akkumulieren. Das können sie dann ohne feste Planung flexibel einsetzen.
„Stellt ein Start-up mitten im Jahr fest, dass dringend Geld für mehr Personal oder eine spezifische Maßnahme notwendig ist, wird es versuchen, dieses Kapital am freien Markt zu besorgen“, sagt Nadine Kammerlander. „Dieser Weg steht den internen Einheiten der Familienunternehmen häufig nicht offen. In unserer Untersuchung haben nur zwei sehr große Unternehmen dieses flexiblere Modell genutzt und damit Kapital gegen Anteile getauscht.“
3. Management muss selbst nicht ins Risiko – wird aber auch an Erfolg nicht beteiligt
Ebenso wie dritte Kapitalgeber beteiligen Familienunternehmen nur sehr selten ihr Top-Management der Innovationseinheiten durch Anteile am Erfolg.
„In der vorliegenden Stichprobe haben nur drei von 37 Unternehmen angegeben, ihr Management am Erfolg durch ‚Equity‘ zu beteiligen – sofern diese nicht ohnehin als aktive Familienmitglieder Teilhaber des Gesamtunternehmens sind“, sagt Nadine Kammerlander.
Damit gehen die Führungskräfte kein eigenes finanzielles Risiko ein.
„Sie werden aber auch eines wichtigen Motivationsfaktors beraubt. Gerade bei Start-ups ist es vollkommen normal, mehrere Gründer bis in späte Phasen hinein am Unternehmen beteiligt zu halten. Das erzeugt Bindung. Viele digitale Köpfe wollen das. Familienunternehmen entgehen damit sicherlich exzellente Talente, die ein Modell, in dem sie nicht selbst eine Beteiligung halten können, als nicht relevant erachten. Denn sie wollen Unternehmerinnen und Unternehmer sein, keine klassischen Angestellten.“
4. Enge Anbindung an Unternehmen fördert Dialog – kostet jedoch Autonomie
„Während nach unserer Beobachtung Konzerne ihren ‚Hubs‘ häufig bewusst hohe Autonomie einräumen, Venture-Capital-Geber den Start-ups operativ freie Hand lassen, ist die Anbindung der Digital- und Innovationszentren bei Familienunternehmen an die Führung des Gesamtunternehmens doch sehr eng“, sagt Nadine Kammerlander.
Das hat durchaus Vorteile: Die Kommunikationswege sind kurz, Ziele lassen sich sehr flexibel re-justieren und Unternehmen und ‚Hub‘ arbeiten nicht aneinander vorbei.
„Gleichzeitig kostet das aber auch Autonomie. Wir haben festgestellt: Bei vielen relevanten Entscheidungen war es nach wie vor notwendig, dass rein formell die bestehende Geschäftsführung der Familie entscheidet – nicht die Führungskräfte in der neuen Einheit. Die Gefahr, dass kreative Ideen in einem größeren Maße sich so doch nicht Bahn brechen können, ist durchaus vorhanden.“
Im Falle der untersuchten Unternehmen waren nur in zehn Fällen separate Gesellschaften gegründet worden. In 16 Fällen wurden die Innovationseinheiten in bestehende Unternehmensbereiche und -abteilungen integriert, in zwölf Fällen neue Bereiche gegründet.
5. Mitarbeiter kommen aus dem eigenen Unternehmen oder werden nach Fachkompetenz rekrutiert – selten aus dem Start-up-Umfeld
Familienunternehmen setzen bei der personellen Ausstattung vor allem auf bewährte Kräfte, die das Unternehmen bereits sehr gut kennen und dort Innovation vorantreiben wollen. Hat ein Vorhaben einen höheren Reifegrad erreicht und werden Kompetenzlücken, zum Beispiel bei Cloud-Computing oder Data Analytics, festgestellt, werden gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen Kompetenzen rekrutiert. Dabei kommen diese aber selten aus dem Eco-System der nationalen oder internationalen Start-ups.
„Familienunternehmen setzen auch hier eher auf Solidität als Kreativität“, sagt Nadine Kammerlander. „Sie erleichtern damit erheblich die Integration der neuen Mitarbeiter, verringern aber auch die Chance auf wirklich radikal neue Ideen und Produkte. Vielen fehlt dazu nicht einfach nur der Mut. Diese Talente sind schlichtweg äußerst schwierig dafür zu gewinnen, zu einem deutschen Traditionsunternehmen zu wechseln, das sein Corporate Venturing wie in der hier beschriebenen Form aufgebaut hat. Auch Konzerne tun sich damit nach wie vor sehr schwer.“
Mike Zöller, Partner bei der auf die Neuausrichtung von Unternehmen spezialisierten Beratungsgesellschaft ANDERSCH, sagt: „Die in dieser Studie nun wissenschaftlich belegten Ansätze zur Innovationsgewinnung im deutschen Mittelstand sehen wir täglich in unserer praktischen Arbeit. Wir nehmen wahr: Ganz der deutschen Seele verhaftet setzen viele Unternehmerfamilien auf Sicherheit – ohne dabei die Chancen aus dem Blickfeld zu verlieren. Es geht eher um Evolution als um Disruption. Um wendiger und vielleicht noch radikal innovativer zu werden, müssten sie allerdings deutlich höhere Risiken eingehen. Welcher Weg den größeren Erfolg beschert, ist noch nicht erwiesen. Wir möchten mit dieser Kontrastierung vor allem Anregung geben, an der ein oder anderen Stelle zu überdenken, wie sich Innovation noch gezielter ‚produzieren‘ lässt.“
Über die Untersuchung
Die Studie wurde durchgeführt am Lehrstuhl für Familienunternehmen der WHU Otto Beisheim School of Management unter der Leitung von Prof. Dr. Nadine Kammerlander und mit Unterstützung der Beratungsgesellschaft ANDERSCH. Es konnten 37 Unternehmen in Familienhand in Form von persönlichen Interviews untersucht werden.
Auszüge aus der Untersuchung sind auf Anfrage hier erhältlich.
(Quelle: ots / ANDERSCH AG; Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay)